Meine schwarzen Quadratbilder III
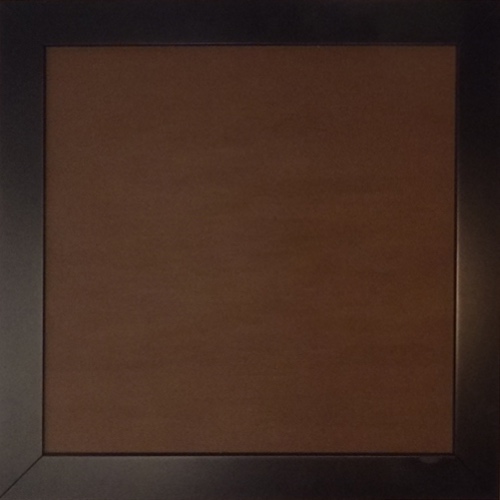
13. März 2012
Letzte Nacht hatte ich einen komischen Traum. Ich beschäftigte mich mit zwei Texten, einer vielleicht eine halbe Seite, der andere noch etwas kürzer. Die Autoren waren Rechtsradikale. Ich sollte diese Texte kritisieren. Wozu sie gedacht waren, ist mir unklar. Sie schienen aber auch für irgendein neues Bild von mir gedacht zu sein. Meiner Einstellung entgegen konnte ich aber nichts Negatives an diesen Texten entdecken.
Dieser Traum könnte mit meinen neuen Schwarzen Quadratbildern zusammenhängen. Das nächste Bild soll nämlich ein schwarzer Rahmen mit einer einfach nur braunen Innenfläche werden. Ich warte nur noch seit Tagen auf entsprechende Presspappen, die mir Markus herstellen will. Nach dem Traum fiel mir ein, dass Schwarz und Braun ja genau die Farben der Nazis waren. Wie soll ich das deuten? Mit der Naziideologie habe ich nun wirklich nichts am Hut. Warum dann aber Braun und Schwarz? Ich habe ja schon vor ein paar Tagen über meine schwarzen Bilder nachgedacht und vermutet, dass sie etwas mit einem festen starken Grund zu tun haben könnten. Vielleicht ist so eine Blut- und Bodenideologie mit ähnlichen Gefühlen verbunden. Die Farbenwahl der Nazis war ja sicher nicht rein zufällig. Für mich haben diese Farben im Moment aber sehr positive, befreiende Wirkung. Das ist alles sehr unklar. Ich will aber von meinen Intuitionen ausgehen und nicht von irgendwelchen rationalen Überlegungen. Wenn Braun, dann Braun, wenn Weiß dann Weiß. Das ist ja auch für mich spannend.
Braun ist aber auch die Farbe der „Mutter Erde“. (s. auch meine Bilder „Regenbogen auf brauen Grund“ und „Besser als gestern, schlechter als morgen“) Braun ist der Grund auf der Ebene des schwarzen Rahmens.

Dem Bild habe ich den Titel „Zu Ehren von Vincent van Gogh, Die Sternennacht“ gegeben. Ich habe es am 25.3.14 beendet. Es kann sein, dass der ein oder andere das Bild als etwas ungehörig ansieht, denn der Mittelpunkt des Bildes ist ein Druck des Gemäldes „Sternennacht“ von van Gogh. Hans-Gerd H. aus unserem Dorf hatte mir vor einiger Zeit einen alten Kalender mit großen Drucken von van Gogh gebracht, weil er ihn nicht einfach wegwerfen wollte. Das Bild „Sternennacht“ ist nun für mich eines der eindrucksvollsten Bilder von van Gogh. Als ich es sah, war ich wieder begeistert und was könnte ein Gemälde mehr vermitteln? Ich hatte dann die Idee, diesen Druck in entsprechendem Rahmen in die Öffentlichkeit zu bringen. Es passt ja durchaus in meine Quadratbilder mit schwarzem Rahmen. Der schwarz Rahmen stellt das Bild in unsere äußere Wirklichkeit. Aus dem weißen Hintergrund – der Transzendent – kommt dieses faszinierende Bild und es führt in diesen transzendenten Raum zurück.
Wie Feuerwellen rollen die Gestirne über den Himmel oder stehen dort mit großem Hof. Der Himmel, der zwei Drittel des Bildes ausmacht, ist ganz durchleuchtet und in der rechten oberen Ecke steht eine orangene Mondsichel, die an ein Bild von C. D. Friedrich – ich glaube es heißt die Mondnacht – erinnert. Auch hier ein erhabenes Zeichen einer anderen Welt, das uns aber vertrauter ist, als die fernen Sterne. Ein Gegenpol zu der fast schwarzen Konifere in der linken unteren Ecke. Sie sieht aus wie eine finstere Flamme, die in den Himmel züngelt. Ein Dorf liegt friedlich im Schutz eines Waldes und von felsigen Bergrücken. Aus einigen Fenstern der Häuser scheint ein warmes Licht. In der Mitte des Bildes zeigt ein spitzer Kirchturm in den Himmel. Vielleicht hatte van Gogh eine Ahnung von der unendlichen Fülle und Energie des sogenannten Vakuums, des leeren Raumes, der eigentlich – wie uns die Quantenphysiker sagen – eher ein Plenum ist.
Damit das Bild nicht vergilbt, habe ich es mit einer Mischung aus Magnesiumcarbonat und Schreinerleim in Wasser aufgelöst von hinten bestrichen und dann aufgeklebt. Ich hoffe, dass das hilft.
14. Mai 2014
Gestern Nacht bin ich vor dem Schlafengehen noch auf den Balkon gegangen, weil der Vollmond schien. Unerwartet kam eine Stimmung von Freude und so etwas wie Geborgenheit in mir auf, etwas wie eine Märchenstimmung, wie ich sie manchmal als Kind erlebt habe. Der Mond bekam wieder ein Gesicht und schaute mich freundlich an, die weite Landschaft, die im entfernt im Dunst verschwand und die Schatten der Häuser des Dorfes nach rechts hin unter mir. Sie erinnerten mich an die „Sternennacht“ von van Gogh. Ich glaube das liegt daran, dass die Quantenphilosophie mir wieder eine Heimat im unendlichen Weltall gegeben hat, in der ich getrost leben kann.

Als ich die Grafik von Simone Frieling in der Zeitschrift „Publik-Forum“ sah, war ich zunächst mal etwas erstaunt. Rosa Luxemburg war mir als kleine, eher etwas übersensible Frau im Gedächtnis, die ich mit einem Büffel nicht in Beziehung gebracht hätte. Dann fiel mir aber ein, warum ich sie schon lange verehrte. Sie war eine radikale Denkerin und eine unbeugsame Revolutionärin, die für Gerechtigkeit und Freiheit der Menschen gekämpft hatte. Vor allem ihre Aufrufe, den Krieg zu verweigern, hatte sie Jahre lang ins Gefängnisse und ins Zuchthaus gebracht. 1919 wurde sie dann brutal ermordet.
Aber alles das sind allgemeine Aussagen, die Rosa Luxemburg nicht gerecht werden.
Zwei Auszüge aus dem Buch von Simone Frieling: Rebellinnen, Hannah Arendt, Rosa Luxemburg und Simone Weil, Berlin 2018, können eine Ahnung von der reichen Persönlichkeit Rosa Luxemburgs geben. In einem Brief aus dem Gefängnis schrieb sie an Sophie Liebknecht:
Und ich lächle im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles Böse und Traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde nichts und muss wieder lächeln über mich selbst. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst; die tiefe nächtliche Finsternis ist so schön und weich wie Sammet, wenn man nur richtig schaut. Und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsam schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines schönes Lied vom Leben wenn man nur richtig zu hören weiß.
„Rosa Luxemburg schildert eine Grenzsituation, wie ein Sterbender sie erleben kann, ein Schwerkranker oder ein Mensch, der völlig gescheitert ist. Sie war gescheitert. Als Politikerin, die wie ihre Mitstreiter Liebknecht und andere im Gefängnis saß und nichts mehr ausrichten konnte. Als Liebende, die ihre große Liebe verloren, die sie für unvergänglich gehalten hatte. Als Aufklärerin und Antimilitaristin, die miterleben musste, wie die eigene Partei Kriegskredite bewilligte und junge Männer, unter dem Jubel der Bevölkerung, in den Ersten Weltkrieg zogen. Der Eintritt Deutschlands am 3. August 1914 in den Krieg hatte sie fast an den Rand des Selbstmords gebracht, im Dezember ihre Verfassung so verschlechtert, dass sie für einige Zeit ins Krankenhaus musste.
Sich ihres Scheiterns bewusst, schreibt Rosa Luxemburg nicht aus Verzweiflung, sondern als Siegerin über sie. In der Grenzsituation der Gefangenschaft, mit Aufhebung des bürgerlichen Lebens, wird ihr erst klar, wer sie ist: ein unabhängiger Mensch. Sie schreibt im vollen Bewusstsein einer Dichterin, die sich zwar an Adressaten wendet, sie aber während des Schreibens vergisst. So wird die Beschreibung der Nacht in ihrer Zelle zu einem Welttext, der von jedem Menschen verstanden wird, gleichgültig, welche Bildung und Nationalität er hat. Denn Not ist die Bekannte eines jeden Menschen.“ S.48f
Eine der stärksten, schönsten und traurigsten Tiererzählungen, die man mit vollem Recht zur Weltliteratur zählen kann, hat Rosa Luxemburg geschrieben. Ihre Beschreibung geschundener Büffel im Gefängnishof von Breslau hat eine Intensivität, die nur ein Mensch erreichen kann, der alles Unwichtige hinter sich gelassen hat:
„Ach, Sonitschka (an Sophie Liebknecht, im gleichen Brief s.o., H.L.), ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt; auf dem Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, voll bepackt mit Säcken oder alten Soldatenröcken und Hemden, oft mit Blutflecken …, die werden hier abgeladen, in die Zellen verteilt, geflickt, dann wieder aufgeladen und ans Militär abgeliefert.“
Zum ersten Mal waren diese Wagen mit Büffeln bespannt, statt mit Pferden. Rosa Luxemburg sah sich die Tiere, die als Kriegstrophäen aus Rumänien kamen, genau an. Die Soldaten, die sie führten, berichteten ihr, wie mühsam es gewesen war, sie zu fangen und zu Lasttieren zu machen. Auch, dass sie schonungslos ausgenutzt und dabei rasch zugrunde gehen würden. Eines Tages beobachtete Luxemburg wie ein Soldat mit dem Ende eines Peitschenstiels auf die Büffel einhieb, weil die Tiere die Schwelle zur Toreinfahrt nicht überwinden konnten. Als die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte, hieb er mit bösem Lächeln noch kräftiger auf sie ein.
Sonitschka, die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit, und die war zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still erschöpft, und eines, das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen, wie ein verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür, weshalb, nicht weiß, wie es der Qual und rohen Gewalt entgehen soll … ich stand davor, und das Tier blickte mich an, mir rannen die Tränen herunter — es waren seine Tränen, man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stille Leid zuckte. Wie weit, wie unerreichbar, verloren die freien, saftigen, grünen Weiden Rumäniens? Wie anders schien dort die Sonne, blies der Wind, wie anders waren die schönen Laute der Vögel oder das melodische Rufen der Hirten. Und hier — diese fremde schaurige Stadt, der dumpfe Stall, das ekelerregende, muffige Heu, mit faulem Stroh gemischt, die fremden, furchtbaren Menschen, und — die Schläge, das Blut, das aus der frischen Wunde rinnt … 0, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder, wir stehen hier beide so ohnmächtig und stumpf und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht.
Dieser Brief an Sophie Liebknecht, mitte Dezember 1917 in Breslau verfasst, erschien 1920 in dem Bändchen Briefe aus dem Gefängnis. Die Briefsammlung war von dem »Verlag der Jugendinternationale« in Berlin herausgegeben worden *, um das Bild der »blutigen Rosa« durch ein anderes zu ersetzen; tatsächlich erregten die Briefe »Anteilnahme und Erstaunen bei Lesern aus allen Lagern«. In der DDR wurde der Brief dann in Schulbücher aufgenommen: Er galt als große politische Parabel vom Format eines Bertolt Brecht, in der die Erbarmungslosigkeit des ersten imperialistischen Weltkrieges dargestellt ist. Unbestreitbar ist der Text aber erst einmal eines: Literatur.“ S. 52-54
Aus diesen Texten geht unter Anderem hervor, dass Rosa Luxemburg eine Mystikerin war, die ihre Stärke aus der Einheit mit der Natur schöpfte. Für diese Verbundenheit und Einheit mit der Natur ist die Grafik von Simone Frieling ein gutes Symbol. Die tiefe Verbundenheit ist bei allen Mystikern mit unendlich tiefem Mitgefühl verbunden.
Als ich die Graphik von Simone Frieling sah, hatte ich gleich den Impuls, sie in ein Bild zu setzen. Wie ich das angemessen machen könnte, war mir aber nicht klar. Nach einer ganzen Reihe von Überlegungen, die aber zu keinem befriedigenden Ergebnis führten, bin ich zu dieser schlichten Lösung gekommen. In die Serie meine schwarzen Quadratbilder passt es ganz gut. Vor allem wird dabei die Grafik von Simone Frieling nicht verfälscht. Im Gegenteil, sie wird sozusagen in den richtigen Rahmen gesetzt. Der Hintergrund des Bildes stellt als weiß Fläche ja die transzendente weite Offenheit und Leere dar, aus der die Erfahrung der Mystiker kommt und aus der letzen Endes alles kommt und zurückkehrt. Die Verbundenheit mit dieser Tiefe der Natur scheint mir Rosa Luxemburg die fast übermenschliche Kraft gegeben zu haben.
Ich habe die Grafik in den linken unteren Quadranten des Bildes gesetzt. Er steht für die Ausrichtung auf den Tod, auf den sie ja fast unvermeidlich zuging.
*Rosa Luxemburg, Briefe aus dem Gefängnis, 2017 im Anaconda-Verlag in Köln neu herausgegeben, 4 €
Wolken, Vögel und Menschentränen
Warum Rosa Luxemburg mich begeistert: ein Brief der Künstlerin und Autorin Simone Frieling an ihre Tochter:
Meine liebe Tochter, Du hast mich gefragt, warum ich mich mit Rosa Luxemburg beschäftige, warum ich monatelang Biografien, politische Schriften und Briefe von ihr lese. Es gäbe doch viel glänzendere Frauengestalten als sie, die man die »blutige Rosa« genannt hat.
Ja, tatsächlich war es dieser hässliche Name, der mich nicht zur Ruhe kommen ließ; er passte so gar nicht zu der nachdenklich blickenden Frau auf den Fotos und noch weniger zu dem einen Brief von ihr, den ich schon vor Jahren in eine Anthologie über das Glück aufgenommen hatte. Du musst Dir vorstellen, da schreibt eine Frau aus dem Gefä.ngnis: »Wie ist es schön, wie bin ich glücklich, man spürt schon beinahe die Johannisstimmung — die volle, üppige Reife des Sommers und den Lebensrausch.« Rosa Luxemburg, die fast bis zu ihrem gewaltsamen Tod inhaftiert war, weil sie die Deutschen vor dem Krieg gewarnt hatte, tröstet hier Sophie Liebknecht, die in Freiheit lebt.
Natürlich liegt der Erste Weltkrieg für Deine Generation in weiter Ferne; euch hat sich viel mehr der Zweite Weltkrieg eingeprägt durch die ungeheuerlichen Verbrechen an den Juden. Von Rosa Luxemburg ist euch vielleicht nur noch der Schimpfname im Gedächtnis. Aber ihre Einschätzung als Pazifistin war richtig: »Der gegenwärtige Weltkrieg übertrifft jedoch alles Bisherige an Dimensionen, an Wucht, an tief greifender Wirkung.« Sie prophezeite: »Freilich werden emsige Hände die Trümmer wieder aufzurichten suchen. Aber materieller Ruin lässt sich eher wieder gutmachen als moralischer.« Dass der verlorene Erste Weltkrieg die Gesellschaft weiter spaltete und den Zweiten Weltkrieg hervorbrachte, hat Luxemburg nicht mehr erlebt; sie wurde vor genau hundert Jahren in Berlin ermordet.
Ich war mit dem Leben und Werk von Rosa Luxemburg nicht vertraut, doch die Biografie von Peter Nettl gab mir einen sehr guten Einblick. Was sie aber zu meiner Vertrauten gemacht hat, sind ihre Briefe — kaum einer, der mich nicht tief berührt hätte. Mir kommt es so vor, als hätte Luxemburg hinter dicken Gefängnismauern oftmals eine größere innere Freiheit besessen als ihre Freunde draußen. Ich bewundere ihren Mut, ihr unabhängiges Denken, ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre Gabe, Härten hinzunehmen. Außerdem teile ich ihre Abscheu vor dem Krieg, den sie als größte Mensch heitskatastrophe ansah, als den »Untergang aller Zivilisation«.
Persönlich verbindet mich aber mit ihr die »Anbetung« der Natur. Sie war eine Naturmystikerin, der das Einssein mit der Natur letztendlich das höchste Gut war. Wie ihre Mutter Line, »die nebst Schiller die Bibel für der höchsten Weisheit Quell hielt«, liebte und bemitleidete sie jede geschundene Kreatur. Sie sagte von sich: »Ich fühle mich in der ganzen Welt zu Hause, wo es Wolken und Vögel und Menschentränen gibt.« Revolutionärin ist sie geworden, weil »die Zeitläufe ihren Sinn für Gerechtigkeit und Freiheit verletzt« haben, wie Hannah Arendt es ausdrückte.
Ihre Beziehung zu Tieren war von anderer Art als die zu Menschen, zu denen sie immer eine letzte Distanz behielt — Tiere konnten ihr nicht nah genug sein. Das Beobachten von Vögeln, ihr Füttern und Zähmen gehörten bis in die letzten Tage der Haft zu ihren glückhaftesten Beschäftigungen. Sie konnte Vogelarten bestimmen, ihre Rufe täuschend echt nachahmen und sie anlocken, kannte ihre Flugrouten und Gewohnheiten. Aber das allein wird nicht der Grund der Anziehung gewesen sein: Vögel waren für sie Wesen von besonderer Art, sie waren eng mit Himmel und Wolken verbunden, waren unabhängig und frei. Weißt Du noch, als ich Dir den »Büffel-Brief« vorgelesen habe? Wir hatten beide Tränen in den Augen. Die Beschreibung geschundener Büffel im Gefängnishof von Breslau endet mit den Worten: »0, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder, wir stehen hier beide so ohnmächtig und stumpf und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht.« Karl Kraus nannte diesen
Brief ein »Dokument von Menschlichkeit und Dichtung«, das »zwischen Goethe und Claudius« in jedes Schulbuch gehöre. Rosa Luxemburg war in ihrem Tier‑
und Menschenbild von tiefstem christlichen Humanismus geprägt — man könnte sie als eine Art weiblichen Franziskus bezeichnen. Deine Mutter
Simone Frieling, geboren 1957, arbeitet als Malerin und Autorin in Mainz. Bei’ebersbach & simon erschien kürzlich ihr Buch »Rebellinnen Hannah Arendt, Rosa Luxemburg und Simone Weil

Gestern habe ich dem schwarzen Bild, dass ich Ende Februar geplant hatte, einen Namen gegeben: memento mori. Er entstammt dem mittelalterlichen Mönchslatein und heiß so viel wie ‚Gedenke zu sterben‘ oder Denke daran, dass du stirbst! Dieser Gedanke hatte in der Reformbewegung der Cluniazenser, einem Mönchsorden im Mittelalter, ein besondere Bedeutung. Er sollte vor allem der Reform des Orden und der Kirche dienen. Das asketische Ideal des Mönchstums, das die Nichtigkeit allen Irdischen klarmachen sollte und auf die Entscheidung des Letzten Gerichts ausgerichtet war, rief auch die Laien zur Weltabkehr auf. Der Mensch sollte sich der Vanitas, dem Gedanken, dass alles Leben vergänglich ist, bewusst werden. In Bezug auf den Tod stand nicht der Erlösungsgedanke im Vordergrund sondern Gericht und Strafe. Das Vanitas- und Memento mori-Motiv zieht sich auch durch die ganze Kunstgeschichte.
Mein schwarzes Quadratbild nimmt das Motiv des „Memento mori“ auf. Auf der schwarzen Fläche steht im linken Quadrant – der Bereich, der auf den Tod ausgerichtet ist, – ein weißes Totengerippe. Es ist aus dem weißen Untergrund herausgearbeitet und bezieht sich damit auf die unter der schwarzen Fläche liegenden Transzendenz. Es ist ein Anruf aus diesem Bereich. Diese Transzendenz ist aber aus meiner kontemplativen Erfahrung heraus und in meiner Bildsprache zwar die Leere, aber nicht die Leere, in der alles vergeht, sondern in die alles aufgenommen wird. Der Tod ist damit nur ein Übergang in eine andere Wirklichkeit. Wie diese Wirklichkeit genau ist, wissen wir nicht, wir wissen aber – und können das anfanghaft erfahren – dass es das unendliche Bewusstsein ist, das auch Gott oder Liebe genannt wird, aus dem alles entsteht und in das alles wieder eingeht.
Das Totengerippe auf der schwarzen Fläche wird trotzdem für die meisten Menschen abschreckend und beängstigend sein. Natürlich wollen wir – wie jede Kreatur – leben und gerade in unserer Kultur schreckt uns nichts mehr als der Tod, den wir weitgehend verdrängen.
Für mich war der Ausgangspunkt, dass auch ich dem Tod nicht freudig entgegen schaue und manchmal zurückschrecke. Ich muss mir darum immer wieder bewusstmachen, dass weder ich noch irgendwer sonst, etwas zu befürchten hat. Das ist die Voraussetzung für ein freies und glückliches Leben.
Das Totengerippe steht aufrecht und erhobenen Hauptes. Es lässt den einen Arm gelassen herabhängen und der andere ist empfangend nach vorne ausgestreckt. Wenn ich mich hingebe und auf Empfangen ausgerichtet bin, habe ich keine Furcht. Das leicht nach hinten geneigte Gerippe zeigt aber trotz allem ein leichtes Erschrecken, dem man wahrscheinlich nicht so leicht entgehen kann.
Christian Meyer
Dem Tod und der Angst begegnen
„Im letzten Schritt geht es darum, dem Tod zu begegnen. Der Tod des Körpers ist der offensichtlichste und naheliegendste Tod; der körperliche Tod ist auch die einzig sichere Tatsache des Lebens. Der Tod des Ichs dagegen ist zunächst, wenn man ihn noch nicht erfahren hat, sehr viel weniger plastisch.
Das Leben selbst ist auch eine Metapher. Sie bedeutet unter anderem, dass die Gewissheit des körperlichen Todes dir die Möglichkeit gibt, dich mit dem Wesentlichen zu befassen, nämlich mit dem Nichts. Insofern ist der körperliche Tod als solches nicht bedeutsam. Er ist nur eine Zukunftsphantasie. Niemand weiß, was anschließend wirklich geschehen wird. Die Erfahrung von körperlichem Tod und Verfall gibt dir ein Bild, eine Metapher, eine Herausforderung, den Sog und das Drängen dahin, das Wesentliche zu finden. Der Tod steht da als die einzig sichere Tatsache des Lebens. Sich dem Tod zu stellen bedeutet nicht, ein mentales Erklärungsmuster heranzuziehen, weder zu sagen: „Ich habe keine Angst vor dem Tod, denn danach ist nichts mehr. Wovor sollte ich Angst haben?“, noch zu sagen: „Ach Gott, ich wünsch mir den Tod, dann ist endlich alles vorbei.“ Es bedeutet, dass Du dich auf der Gefühlsebene, auf der Erfahrungsebene dem Nichts stellst, dem Ego-Tod.
Nichts zu wissen, nichts zu haben, keine Pläne mehr zu haben, keine Kontrolle zu haben.
So heißt es auch im tibetischen Totenbuch: ‚Wenn wir den Tod verstehen, dann verstehen wir zu leben.‘ Der Tod ist in jedem Augenblick erfahrbar als das innere Nichts, die innere Bodenlosigkeit. Der Tod muss nicht noch dreißig Jahre auf dich warten oder Du auf den Tod, um ihn zu erfahren.
Du erfährst das Nichts, wenn Du so sehr loslässt, dass Du in dieser Bodenlosigkeit versinkst.
Tot sein heißt in erster Linie, keine Zukunft mehr zu haben. Sterben heißt, die Zukunft aufzugeben. Und wenn Du die Zukunft aufgibst, dann fliegt die Vergangenheit auch weg. Zukunft bedeutet: Ich muss noch etwas erledigen. Ich will etwas noch besser machen. Ich will noch unbedingt dies und jenes zu Ende bringen. All das ist Teil deiner Vergangenheit. Wenn Du das beendest und sagst: ‚Ich will nichts mehr‘, dann fliegt deine Vergangenheit weg. Dann gibt es keinen Menschen aus der Vergangenheit mehr, mit dem Du noch etwas zu erledigen hättest. Dann haderst Du mit niemandem mehr, weil Du nichts mehr willst.
Verschwindet die Zukunft, verschwindet gleichzeitig auch die Vergangenheit.
Das hat nichts damit zu tun, sterben zu wollen, oder mit dem Tod des Körpers. In dem fünften Schritt geht es um die Bereitwilligkeit, das als Erfahrung anzunehmen, was ist: Die eigene Sterblichkeit. Es geht nicht darum, sterben zu wollen, um seine Ruhe zu haben.
Nicht sterben wollen, etwa um seine Ruhe zu haben, sondern bereit sein zu sterben, auch wenn Du das Leben liebst, wann auch immer es geschehen soll, und wenn es in diesem Augenblick wäre.“

Diese Bild hat mit einer neuen Erkenntnis in Bezug auf Meditation zu tun.
Bei der Ausrichtung der Meditation müssen wir wieder lernen, von unserm Körper auszugehen und auf unseren Körper zu hören, von dem wir im Westen oft sehr entfremdet sind. Das ist der Grund, warum wir häufig in unserer Entwicklung stecken bleiben. Wir haben vergessen, dass unser Körper und die Erde ein wichtiger Aspekt unsers eigenen tieferen Selbst sind. Unsere Spiritualität ist oft extrem von der Erde abgetrennt. Wir müssen in gewisser Weise wieder Boden unter den Füßen bekommen. Der amerikanische Religionssoziologe und Meditationslehrer Dr. Reginald Ray hat seinen Forschungsreisen bei indigenen Völkern festgestellt, dass man in diesen Kulturen schon daran, wie die Menschen über den Borden gehen, ihre tiefe Verbundenheit mit der Erde erkennen kann. Wir schweben oft wie Luftkissen über dem Boden, halten uns fern von der Erde, die uns auch aus unserer Tradition heraus eher dunkel und feindlich erscheint. Spiritualität kann dann heißen, sich möglichst von der Erde abzuwenden, gerade auch in der Meditation. Die Aufgabe ist, sich wieder tiefer in der Erde zu verwurzeln.
Die feste Verbindung mit der Erde scheint mir die kleine Abbildung auf einem Buch mit Afrikanischen Märchen eindrucksvoll zu demonstrieren. Ein hockender Mensch hat sein Gleichgewicht auf überproportional großen Füßen gefunden. Der Boden gibt ihm festen Halt. Dort ist er verwurzelt.
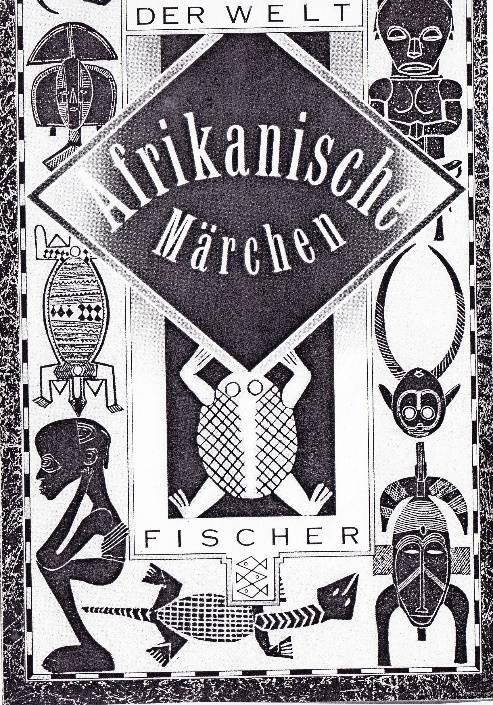
Der Weg zum Weiß des transzendenten Hintergrunds muss auch über die Verbindung mit der Erde gehen.
Juni 2023

Im Frühjahr 2023 bot eine Nachbarin in Hardenberg einen Malkurs mit Naturfarben an mit dem Thema Höhlenmalerei. Da Höhlenmalerei mich sehr interessiert, habe ich mich angemeldet. In diesem Kurs ging es aber mehr darum mit Naturfarben sich selbst auszurücken mit dem Blick auf Höhlenmalerei. Mein Interesse gilt aber dem Sinn der Höhlenmalerei. Was wollten die Menschen vor 10-30 tausend Jahren mit diesen ihren Gemälden. Ich tat mich also schwer, einfach zu malen, was bei anderen Kursteilnehmern durchaus interessante Ergebnisse brachte. Ich überlegte länger, wie die Situation der frühen Menschen war. Ich wollte dann ein Bild malen, auf dem im linken unteren Quadranten des Bildes ein Jäger mit Pfeil und Bogen vor einem übermächtigen Bison stand, der fast die ganze Mitte des Bildes einnahm und die Übermächtigkeit der Natur darstellen sollte, mit der der Jäger um sein und das Leben seiner Gruppe zu kämpfen hatte, z. B. auch um Nahrung zu beschaffen. Im rechten unteren Quadranten hielt ich eine Fläche frei für diese Gruppe, die dort ihr Leben gestaltete. Im rechten oberen Quadranten sollt nur noch eine Sonne zu sehen sein. Die Zeit reichte dann aber nicht für dieses Bild und es kam mir auch zu kopfgesteuert vor.
Etwa einen Monat später fand ich dann in der Zeitschrift der kath. Religionslehrer an berufsbildenden Schulen einen Artikel, der mich fasziniert und zu dem jetzigen Bild angeregt. Auf dem Ausschnitt des Höhlenbildes stand als zentrale Figur ein mächtiger Bison, vor dem ein offensichtlich toter Jäger lag. Diese Konstellation entsprach in etwa meiner Intuition im Malkurs, nur dass der Jäger tot war. Den Rest beschreibt der Artikel sehr eindrucksvoll.
Auferstehungsglaube am Beginn der Menschheitsgeschichte von Tobias Hausmann
Das Weiterleben nach dem Tod ist eine zentrale Aussage im Christentum. Und trotzdem haben sehr viele Menschen heutzutage mit dieser Vorstellung ihre Schwierigkeiten. Sie lehnen sie ab oder wollen sich nicht damit befassen. Dabei ist diese Frage ein Uranliegen, das schon unsere Vorfahren hatten. Auch wenn uns schriftliche Quellen fehlen, hinterließen sie uns einen Anhalt, dass sie sich mit dieser Frage auseinandersetzten. Und sie nutzten dabei eine symbolhafte Sprache, mit der sie ihr Denken über den Tod hinaus uns hinterließen. Wir treten damit eine Reise in die Vergangenheit von mehr als 17.000 Jahren an. Je nach Theorie können die Höhlenbilder in Lascaux wesentlich älter sein. Damals lebten unsere Vorfahren als Nomaden. Sie zogen den Tierherden hinterher, um sie zu jagen. Mitten in Frankreich wurden Höhlenmalereien dieser Menschen entdeckt.
Höhlen sind kein Wohnraum
Eine Höhle war sicherlich alles andere als ein Wohnort, denn dort gab es kein natürliches Licht. Gefährliche Tiere konnten in der Höhle hausen. Außerdem ist die Temperatur eher mit unserer Kühlschrankinnentemperatur vergleichbar, statt unserer Wohlfühl-Wohnzimmer-Temperatur. Sicherlich beherrschten sie das Feuermachen, aber das machten sie wohl kaum im Innersten einer Höhle — denn wohin sollte der Rauch entweichen? Und sie hatten bestimmt auch bemerkt, dass die Luft dann knapp wird — wir wissen heute, dass beim Verbrennen Sauerstoff benötigt wird, den der Mensch zum Atmen braucht. So wurde in Zelten oder am Höhleneingang bzw. in einer Felsnische gewohnt. Nun sind die Höhlenmalereien bei Lascaux tief in die Höhle gemalt. Und wenn man genauer sich die Bilder ansieht, dann wurden diese an den Wänden weiter oben angebracht, wo sie ohne Hilfsmittel wie einer Leiter oder einem Huckepack-Tragen nicht angefertigt werden konnten. Selbst dann nicht, wenn die Menschen früher durchschnittlich größer waren als heutzutage. Die Bilder wurden also innerhalb der Höhle an nicht direkt erreichbaren Wänden angebracht. In einem acht Meter langen und sehr engen Gang, der kaum für einen Menschen zu begehen ist, wurden auch Bilder angefertigt. Da die Menschen nicht dort wohnten, waren diese Malereien sicherlich nicht als Wohnraumdekoration angebracht! Warum der ganze Aufwand? In dem Höhlensystem ist eine gewisse Systematik erkennbar, so dass gewisse Tiere in gewisse Richtungen gezeichnet wurden. Mit der Systematik der Malerei ist eine durchdachte Struktur zu erkennen.
Eine tödliche Jagdszene
Ein besonders interessantes Bild zeigt einen Wisent sowie einen Menschen mit ausgebreiteten Armen und jeweils vier Fingern an jeder Hand. Der Mensch hat einen vogelähnlichen Kopf und ein Vogel ist auch unter dem Menschen gezeichnet. Außerdem ist ein Penis zu erkennen, womit es sich bei dem Menschen um einen Mann handelt. In dem Wisent ist ein langer, gerader Strich gezeichnet, was für ein Speer spricht. Der Mann hat mit dem Speer den Wisent gejagt und ihn auch getroffen.
Die Hinterläufe des Wisents sind mehrfach gezeichnet worden, wodurch eine Bewegung des Wisents Richtung Mann angedeutet wird. Vielleicht nimmt der Wisent in seinem verletzten Zustand Anlauf. Die Hörner sind dem Mann entgegengestreckt. Der Wisent versucht in seinem Todeskampf, sich zu wehren und möchte seinen Jäger töten. Somit sterben beide — der Jäger genauso wie der Gejagte. Sie haben sich beide gegenseitig getötet. In diesem Zustand verwandelt sich der Mensch. Seine Hände haben nur noch jeweils vier Finger und sein Kopf wird zu einem Vogelkopf. Der Mensch wird im Tod zu einem Vogel. Vögel sind Lebewesen mit vier Fingern bzw. Krallen; deswegen auch die Darstellung der vier Finger und des Kopfes. Und auch das Bild des weiteren Vogels.
In einer lebensfeindlichen Höhle wird ein Bild gemalt, wo der Mensch im Tod zu einem Vogel wird. Vielleicht ist dies für die damaligen Menschen eine Antwort auf das Jenseits. Eine Sinnantwort darauf, dass nicht alles mit dem Tod vorüber ist, dass die Todesgefahr, die beim Jagen entsteht, somit auch ausgehalten werden kann. Sicherlich gab es Jagdunfälle, die durch geringe medizinische Kenntnisse meist tödlich endeten.


Deutungsversuche
Die Höhlenmalereien sind religiöser Ausdruck der damaligen Menschen.
Wer malt in die Tiefe der lebensfeindlichen Welt derartige Bilder? Menschen, die in der Höhle eine andere jenseitige Welt sehen, die die Lebensfeindlichkeit den damaligen Menschen im Diesseits bewusst macht. Und diese Welt scheint dem Menschen die Vorstellung zu ermöglichen, dass mit dem Tod nicht alles vorüber ist, sondern eine Verwandlung stattfindet. Eine Verwandlung in einen Vogel. Selbst der Theologe Hans Küng nutze das Bild der Verwandlung von einer Raupe zu einem Schmetterling als Bild für den Auferstehungsglauben.
Für die Menschen vor 17.000 Jahren war vermutlich die Situation des Todes nicht aushaltbar und sie begannen nachzudenken. Ihre Ergebnisse malten sie an einem Ort jenseits ihrer Lebenswelt, der Höhle, und wählten die Situation „Großwildjagd“. Der getötete Jäger verwandelt sich in einen Vogel, um in den Himmel aufzusteigen.
Mit dieser religiösen Sprache arbeiten wir noch heute: Er fährt in den Himmel auf oder der Heilige Geist erscheint in Gestalt einer Taube. Sicherlich haben die Menschen auch nicht beobachten können, dass nach dem Tod ein Mensch sich in einen Vogel verwandelt. Aber die Frage nach dem Tod gehört zum Menschsein dazu. Und die symbolhafte Sprache ist die einzige Möglichkeit, eine Antwort zu formulieren – vor 17.000 Jahren, wie auch heute.
Neben dem Beginn einer Religiosität und einer Jenseitsvorstellung ist hier auch deutlich, dass die Religion im Laufe der Entwicklung der Menschheit hinzugekommen ist. Nicht als Regelwerk für ein Gott gefälliges Leben oder der Ausübung von Macht durch die Kirche, sondern in Form einer menschlichen Eigenschaft. Das Denken über den Tod hinaus macht den Menschen zum Menschen. Hier könnte auch die Bestattung von Toten als Beispiel angeführt werden. Die Höhlenmalerei setzt ein Bewusstsein voraus, das den Menschen vom Tier unterscheidet. Nur der Mensch kann mit einem anderen Menschen kommunizieren, ohne diesen Menschen zu kennen, auch nach der eigenen Lebenszeit. Das Tier kann das nicht. Der Löwe kann nicht Hinweise in einer Höhle für einen anderen Löwen hinterlassen, wo die besten Jagdreviere in der Gegend zu finden sind.
Der Mensch kann sich anderen Menschen mitteilen. Das wird auch heutzutage in den sozialen Medien immer wieder gemacht. Es werden Erkenntnisse von Menschen verarbeitet und die Weiterentwicklung auch über deren eigene Schaffenstätigkeit hinaus betrachtet, sonst könnten solche technischen Errungenschaften wie zum Beispiel Telefon, Handy, Computer, Satelliten oder das Internet wohl kaum entwickelt werden. Dies funktioniert nur mit einem ausgeprägten menschlichen Bewusstsein, dessen Anfang durch das „Denken über den Tod hinaus“ am Beginn der kulturellen Menschheitsgeschichte steht. Und mit diesem Verständnis ist auch nur eine klimafreundliche und ressourcenschonende Politik zu verbinden. Nur wer daran glaubt, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, kann entsprechend für die nächste Generation Maßnahmen im Hier und Jetzt ergreifen, die erst langfristig wirksam werden und über den eigenen Tod hinausgehen können.
Wir wissen nicht, ob die Bilder in der Höhle von Lascaux diesen Zweck, der Nachwelt etwas mitzuteilen, ursprünglich erfüllen sollten. Sie sind erhalten, und heute schauen wir nun auf diese Bilder und versuchen den Sinn zu deuten. Und besonders bei dem Mann mit dem Vogelkopf und dem Wisent ist ein menschliches Bewusstsein sichtbar für eine Verwandlung im Sterben, die bis heute in ein religiöses Sprachmuster passt.

Tobias Hausmann ist Lehrer für Elektrotechnik und kath. Religionslehre am Thomas-Eßer-Berufskolleg in Euskirchen
Die einzige Darstellung eines Menschen in der Höhle von Lascaux ist diese Jagddarstellung mit dem toten Jäger.
Die religiöse Bedeutung der Höhlenmalerei
Als der Urmensch, dieses vergleichsweise kleine und schmächtige Lebewesen, nur mit einem Holzspeer als Symbol seiner aufgerichteten Tötungspotenz24 bewaffnet, den wütenden Bison, den zähnefletschenden Höhlenbären oder das riesige Mammut zu Tode stieß, hatte er wahrscheinlich das Gefühl, dabei eine über und in ihm waltende Schicksalsmacht, wie sie ihm auch im Blitz und Donner begegnete, zu töten und sich essend ihre Kraft einzuverleiben.
24 Zum Zusammenhang von Tötungsgewalt und Sexualität, vgl. Baudler, 1991, S. 54-65
Ein alternder spanischer Stierkämpfer, der auf Mallorca eine Kneipe führte, deren Wände mit Stierkampfbildern übersät waren, sagte mir, als ich in einem Gespräch vorsichtig auf das Unsinnige dieser Tiertötung hinzuweisen versuchte, mit großem Pathos und wild rollenden Augen, er habe in seinem Leben niemals gegen ein Tier gekämpft, sondern immer gegen „la morte“, den Tod. Auch in der Frühzeit geschah das Töten dieser mächtigen Tiere ja nicht aus der Notwendigkeit des Nahrungserwerbs; dazu gab es genügend kleinere und leichter erjagbare Tiere. Die Tötung des großen und starken Tieres, vorwiegend des — in der Regel schwarzen — Stiers, war wohl immer schon ein kultischer Akt, in dem der Mensch symbolisch die göttliche Schicksals- und Naturgewalt an sich zu reißen, zu überwinden und essend sich einzuverleiben suchte, biblisch ausgedrückt ein „Sein-Wollen-wie-Gott“, ein Griff nach dem Baum in der Mitte des Gartens Eden (vgl. Gen 3-5; dazu Baudler 1991, S. 215-219).
Dabei konnte dieses gewaltsame An-sich-Reißen des Göttlichen, obwohl der Haltung nach kontrapunktisch, doch vorzüglich mit der Opfer-Haltung und Opfer-Praxis verbunden werden: Der Mensch brauchte nur einen bestimmten — nicht zu klein bemessenen — Teil des erbeuteten und getöteten „Gottesstiers“ nicht selber zu essen, sondern als Brandopfer für die Gottheit darzubringen. Dann war in einer Handlung zweierlei erreicht: Einmal hatte der Mensch ein Opfer dargebracht, das die Schicksalsmacht besänftigen und gütlich stimmen konnte, und zum anderen hatte er sich in der Bereitung dieser Opfergabe selbst als todgewaltiger Held erwiesen, der tödliche Blitze auf mächtige Lebewesen schleudert und der deshalb würdig ist, an der Tafel der Götter zu sitzen und von demselben Fleisch zu essen, das sie, von den Menschen als Opferspeise dargebracht, genossen. So auf Du und Du mit der Schicksalsmacht konnte ihn wohl nicht so schnell, von ihr herkommend, ein tödlicher Blitzstrahl treffen. Als (künstliches) Raubtier am Ende der Nahrungskette stehend, glaubte er, den Tod überwunden zu haben und unsterblich zu sein wie die Götter. (S. 30f)
…
Das Beutetier Mensch, das sich mit Hilfe künstlich hergestellter Stoß- und Schlagwerkzeuge in ein — künstliches — Raubtier verwandelte, also vom Beutestatus in den Jägerstatus überwechselte, sah in der Tötungsgewalt, die es an sich gerissen hatte, die überragende Gottesmacht. Diese Macht immer neu zu demonstrieren, war ihm ein existenzielles Anliegen, weil es seinen göttlichen Jägerstatus stärkte und sicherte. Wahrscheinlich war auch die Jagd auf große gewaltige Tiere, auf Mammut, Bison, Nashorn, Bär und Höhlenlöwe, wie sie in den Höhlenzeichnungen dargestellt und durch viele Funde belegt ist, von daher motiviert. Das Fundmaterial lässt ja erkennen, dass an den Lagerplätzen des Eiszeitmenschen nicht diese gewaltigen Tiere, sondern kleineres Wild (Rentiere, Gazellen, Buschschweine) verzehrt wurde. Darüber hinaus wissen wir von heute lebenden Jägerstämmen, dass der überwiegende Nahrungsanteil nicht durch die Jagd der Männer, sondern durch die Sammeltätigkeit der Frauen besorgt wurde. Die Jagd auf das große gewaltige Tier war allenfalls sekundär durch die Notwendigkeit der Nahrungsbeschaffung motiviert. In erster Linie war sie ein Akt, in dem der Mensch immer neu seine Ur-Rebellion, nämlich den Übergang vom Beute- zum Jägerstatus, vollzog und diesen seinen neugewonnenen Status zu festigen suchte. Sie verfolgte dasselbe Ziel wie die Blutrache, ja war ursprünglich vielleicht deren wichtigstes Instrumentarium. Wie die berühmte Jagdszene aus der Höhle von Lascaux, wo der eiszeitliche Jäger von einem verwundeten Bison niedergetrampelt wird, zeigt110, war die Tötung dieser gewaltigen Tiere mit Hilfe von Holzspeer und Faustkeil mindestens ebenso gefährlich wie später die Tötung eines Menschen aus der gegnerischen Sippe. Erst dem mit Schwert und eiserner Lanze bewaffneten Achill genügte es nicht mehr, den Tod seines Freundes Patroklos durch die Hinschlachtung von Rindern zu rächen, sondern es mussten dafür zwölf gefangene Trojaner, die wiederum von ihren Angehörigen gerächt werden würden, ihr Leben lassen. Dieses grausame Spiel, das heute noch den Kern zumindest aller nationalistisch motivierten Kriege bildet (vgl. Ehrenreich), setzt voraus, dass die Tötungsgewalt als göttliche Schicksalsmacht gesehen wird, die der Mensch in einer Art Angstfaszination jeweils neu an sich reißt. Sie wird auch in den übermächtigen Naturgewalten verehrt.
Die Faszination des Lebens: der innere Beweggrund für die Entwicklung des Rechts
Doch es gibt seit Urzeiten auch noch eine andere Faszination. Sie besteht darin, dass der Mensch in der Ausübung seiner Sexualität eine ekstatische Lebenssteigerung erfährt und aus diesem Geschehen neues menschliches Leben erwächst, das, von der Frau und Mutter gepflegt und genährt, zum vollen Menschsein heranreift. Die altsteinzeitlichen Höhlenwände sind auch von Einritzungen übersät, die kaum anders denn als sexuelle Symbole gedeutet werden können
110 Zur Interpretation dieses Bildes vgl. G. Baudler, 1989, S. 203-208.
Der französische Vorgeschichtsforscher A. Leroi-Gourhan hat versucht, ein alle Lebensbereiche umfassendes sexualsymbolisches Zeichensystem aus diesen Felszeichnungen zu entwickeln111. Wenn diese umfassende Systematik in der Forschung auch sehr umstritten ist, so steht doch unzweifelhaft fest, dass in der eiszeitlichen Höhlenkunst die Symbolik der Sexualität und der Frau neben der Symbolik des großen und gewaltigen Tiers und der Symbolik der Jagd eine wichtige Rolle spielt. Am bekanntesten ist vielleicht die sogenannte „Venus von Laussel“, ein etwa 25.000 Jahre altes Felsrelief, das eine nackte Frau mit breiten ausladenden Hüften und vollen Brüsten zeigt, die in der rechten Hand ein mit Kerbungen verziertes Füllhorn trägt und ihre linke Hand auf den sich vorwölbenden offenbar schwangeren — Leib legt112. Ähnliche „Frauenidole“ sind auch an fast allen eiszeitlichen Lagerplätzen von Sibirien über Ungarn, Tschechien bis Frankreich und Nordspanien, aus Knochen oder Elfenbein geschnitzt, gefunden worden.
Neben der Faszination der Tötungsgewalt scheint hier eine andere Faszination am Werk zu sein, die man vielleicht etwas vereinfacht als Faszination des Lebens und der Lebensweitergabe bezeichnen könnte. Vereinfacht ist diese Gegenüberstellung vor allem deshalb, weil im Übergang vom Beutestatus zum Jägerstatus und in der Ausbildung der menschlichen Tötungsgewalt die Sexualität, besonders die männliche, selbst eine wichtige Rolle spielt. Sie bildet das Triebpotential, das der Mensch im Übergang vom Beute- zum Jägerstatus zum Tötungstrieb umgeformt hat. Die Stoßlanze, das wohl älteste ausschließlich zum Töten hergestellte Werkzeug, fungiert im Zu-Tode-Stoßen als eine Art künstlicher Phallus. Auch Sigmund Freud erkannte ja in Träumen auftauchende Waffen — Schwert, Dolch, Revolver, Gewehrlauf — als Phallussymbole (genauer dazu Baudler 1991, S. 54-64). Deshalb ist in allen Kulturen der Jäger, Krieger und Opferpriester, also der den neuen Status öffentlich darstellende Mensch — wie stets auch der Bluträcher, der diesen Status für die eigene Sippe zurückzugewinnen hat —, ein Mann. Doch trotz dieser Verflechtung von Jägerstatus, Tötungsgewalt und Sexualität (die ja nie nur einseitig auf männliche Sexualität begrenzt werden kann, weil sie mit der weiblichen Sexualität in einer inneren Beziehung steht) scheint es von Anfang an auch eine mit Sexualität und Nahrungsaufnahme verbundene Faszination des Lebens und des Mitlebewesens gegeben zu haben, die zwar von der Faszination der Tötungsgewalt weitgehend überdeckt und zugeschüttet ist, aber an einigen Stellen doch als eigenständige Kraft in Erscheinung tritt: eben etwa in der eiszeitlichen Höhlenkunst und den gefundenen Frauenidolen, aber auch in den schon sehr früh anzusetzenden Bestattungsformen, die eine liebevolle pflegerische Zuwendung zum Verstorbenen zum Ausdruck bringen und — damit zusammenhängend — in der Seßhaftwerdung des Menschen und den damit verbundenen Bestattungskulten sowie in späteren matriarchalen Kultformen (genauer dazu Baudler 1991, S. 117-160).
Könnte es nicht sein, dass auch die Motivation zur Eindämmung der Blutrache und damit zur Ausbildung des Rechts dieser — religiösen — Wurzel entspringt? Wir sind zu sehr gewohnt, das Religiöse immer nur als im kultischen Raum angesiedelt wahrzunehmen; dort wirkt aber vornehmlich jene Religiosität, die aus der Faszination der Tötungsgewalt entspringt. Sie bedarf des eingegrenzten kultischen Raums, um innerhalb dieses Raums — etwa in der Opfertötung eines Tieres oder Menschen — gefahrlos ausagiert werden zu können, ohne auf die profanen Räume überzuspringen, diese vielmehr von der Gewalt zu entleeren. Anders ist es mit der in der Faszination des Lebens gegründeten Religiosität. Sie bedarf keiner abgegrenzten Bezirke, sondern kann sich überall mitten im Leben entfalten. (S. 195 bis 198)
Baudler, Georg: Die Befreiung von einem Gott der Gewalt, Erlösung in der Religionsgeschichte von Judentum, Christentum und Islam, Düsseldorf 1999
